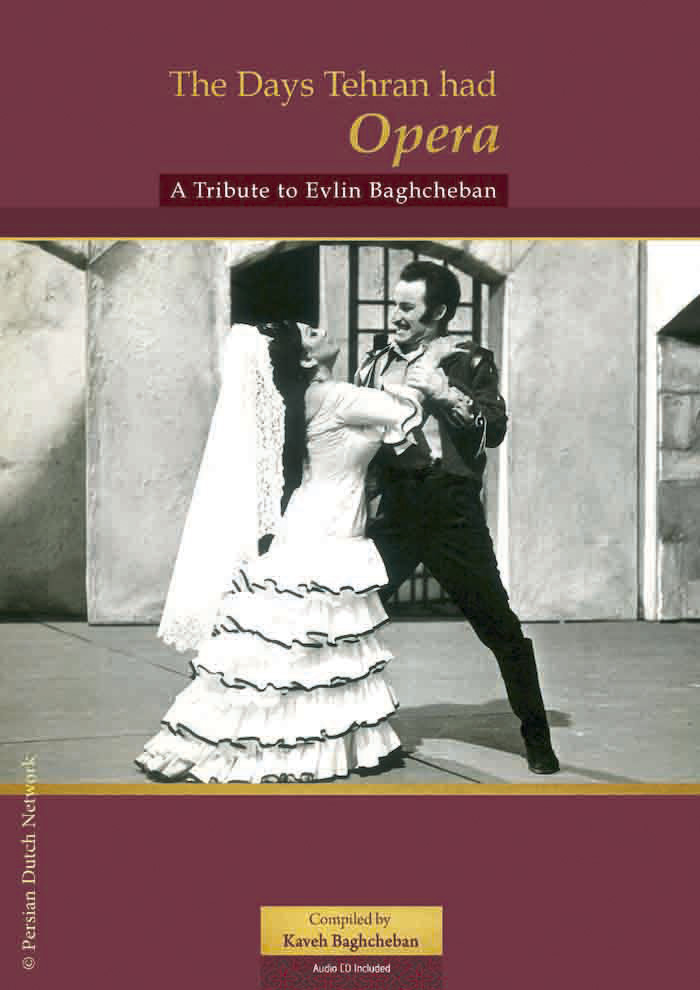Im Gespräch mit Jonathan Tetelman
Schwarze Mähne, trainiert-schlanke 1,93-Figur. Ein Bild von einem Mann! Äußerlich erfüllt Jonathan Tetelman fast alle „Latin Lover“-Klischees und bringt eine heute unumgängliche TV-Smartness auf die Bühne und vor die Kamera: „The guy is a total star“, schrieb die New York Times über ihn. Und gerade jetzt, nach dem Berliner Erfolg in Riccardo Zandonais „Francesca da Rimini“, kommt ihm seine angeborene Bodenhaftung und der nüchterne Blick für gefährliche Angebote besonders zugute: Folglich will er „kürzertreten“ – und so fand sich Zeit für ein ruhiges Gespräch.
Interview Dr. Wolf-Dieter Peter
Was ist derzeit die größte Gefahr für Sie?
„Zu viel zu früh“-Rollen, die vom „Spinto“ ins Heroische reichen – so etwas wie der Bandit Dick in „La fanciulla del West“ oder Florestan. Auch nach Lohengrin wurde ich schon gefragt – und habe abgelehnt. Man kann einmal im Jahr etwas riskieren, aber mit Überlegung und Planung: kein zu großes Haus, kein blind fordernder Dirigent …
Viele Kollegen sagen, dass nach viel Italianità Mozart dann immer wieder eine Schulung und Erholung sei …
Leider gibt es da nicht so viel für mich. Auch im italienischen Fach: Die Tessitur etwa von Nemorino passt nicht so recht. Also arbeite ich viel an Farben in der Stimme – ich denke schon mal an Pollione in „Norma“ und befasse mich mit dem frühen Verdi. Gerade erarbeite ich „Stiffelio“, eine komplexe, schwierige Rolle, aber mit die schönste Musik, die Verdi geschrieben hat und deutlich unterschätzt wird. Hoffentlich im Herbst …
Nach diesem Ausblick einmal zurück: Ihre Anfänge?
Ich bin auf einer Insel in Südchile geboren, mit sechs Monaten von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert worden und dann in Princeton, New Jersey aufgewachsen. Dort kam ich in der American Boychoir School als Knabensopran in den Chor und liebte es. Nach dem Stimmbruch begann ich als Bariton am Mannas College of Music, traf auf sehr gute Lehrer, die sagten „Kommen Sie wieder als Tenor“ – und mit Rossini war ich noch nicht auf meinem Weg. Ich nahm also nicht die übliche „middle-life-“ (lacht), sondern eher eine „Viertellebens-Krise“ und arbeitete drei Jahre als DJ … so von Paycheck zu Paycheck. Das war es dann auch nicht, wie sich herausstellte. Da war ich 26 und entschloss mich innerlich, mich ernsthaft und mit Disziplin aufs Singen zu konzentrieren. Tenorlage.
Gab es Vorbilder?
Natürlich hörte ich viel Caruso, dann di Stefano, del Monaco, auch Franco Corelli. Und der junge Jonas Kaufmann war ein aktuelles Beispiel, wie man seinen Weg zum voll entwickelten lyrischen Tenor geht.
Und ein Carlo Bergonzi?
Der kam später – eben mit dem und für das Stilgefühl.

Gab es dazu dann auch den richtigen Stimmlehrer für diesen Weg?
Man ist anfangs sehr allein. Es ist nicht leicht, jemanden zu treffen, der einen über alles Vokale hinaus auch als Person und Mensch versteht. Ich habe ihn in Mark Schnaible gefunden und bin auch jetzt noch immer wieder mit ihm in Kontakt.
Sie als junger, angehender Sänger in den USA – was bedeutete das musikalische Europa für Sie?
Ich wusste sehr wenig. Aber als ich dann nach erfolgreichem Vorsingen das erste Mal im London Coliseum stand, wurden mir die Tradition und allmählich auch die ganze Breite klar: Dass es dort verstreut viele Opernhäuser gibt, die älter als die USA sind, dass diese Räume meist so gebaut wurden, dass sie unsere Stimmen tragen und man ohne Mikrofon singen kann …
Wie war es mit der Sprach-Ausbildung? Ist die nicht ausgezeichnet im US-Musikstudium?
Leider nicht. Ich lernte Italienisch sozusagen entlang des jeweiligen Werkes. Das geht bei uns leider nicht in die Tiefe. Natürlich kann man es studieren, aber das wird dann in den USA sehr teuer.
Oh – und ich lese den „Fledermaus“-Eisenstein in Ihrem Repertoire und denke, wir können Deutsch sprechen …
Leider nein. Wir machten das herrliche Stück komplett auf Deutsch, mit allem Dialog, zwei Monate Einstudierung – und ich glaube, mein Deutsch war wirklich gut. Aber dann kam nichts mehr und ich habe alles vergessen … (lacht)
Gibt es englischsprachige Rollen – auch Werke, die wir hier nicht kennen –, die Sie gerne singen?
Nichts, was ich jetzt präsent hätte. Ich habe „The Dream of Gerontius“ von Elgar gesungen – eine herausfordernde Rolle, die ich liebte und gerne wieder singen würde.
Sie kamen dann auch an deutsche Opernhäuser und begegneten dem, was in der konservativen Opern-Sponsoren-Szene der USA oft als „German Trash“ bezeichnet wird: dem deutschen „Regietheater“. Sie sangen Rodolfo an der Komischen Oper Berlin in der Inszenierung von Barrie Kosky – eine Erfahrung der anderen Art?
Ich mag grundsätzlich beides, eine historisch genau angesiedelte Szene wie auch eine ganz neue Sicht. Bei Kosky war es diese Idee mit den alten Fotografien, die dann in der Imagination der Zuschauer zum Leben erwachen sollten. Das hat wunderbar geklappt und diesen anderen Zugang bestätigt: dass die Phantasie in der Oper angeregt wird und sie eben nicht nur ein festes Stück ist. Speziell junge Zuschauer hat das sehr angesprochen.
Und dann Riccardo Zandonais wenig bekannte „Francesca da Rimini“ unter der Regie von Christof Loy. Eine Erfahrung der noch einmal ganz anderen Art?
Ja, Christof Loy, das war besonders. Er kam und besprach mit uns eingehend, dass er die zeitlose Gültigkeit der Inhalte zeigen will. Er hatte alles verstanden und im Kopf, die „Hausarbeit vor der Arbeit“ gemacht. Er gab uns den Subtext, die Umgebung zu jedem Charakter und entwickelte daraus diese vielen kleinen Spielzüge. Man muss die Aufführung sicher mehrmals sehen, um alles zu entdecken. Selbst wenn man gerade nicht singt, muss man auf der Bühne mit(er)leben und reagieren – und dann atmete Loy mit und verstand, dass man jetzt in der Lage sein muss, den Ton zu produzieren, zu singen. Bemerkenswert und selten, dieses Vorgehen. Ich habe verstanden, dass es wichtiger und expressiver ist, als in einem tollen Kostüm dazustehen.

Von dieser sicher herrlichen Erfahrung einmal zu den Schattenseiten des Sängerberufs …
So sehr ich es liebe, in vielen verschiedenen Häusern zu singen: Man reist viel und ist oft allein. Ich vermisse meine Eltern oft und habe viele Freunde von früher verloren, einfach weil wir nichts mehr zusammen machen und erleben können. Das muss man akzeptieren und eben Konzentration und Ernsthaftigkeit mitbringen, nie Mittelmäßigkeit akzeptieren. Ja, ich sage sogar ein bisschen „blood, sweat and tears“ gehört dazu, eben die Leidenschaft für diesen Beruf.
Das klingt, als bliebe keine Zeit für ein Hobby.
Wenig. Ich interessiere mich für alte Uhren und sammle ein bisschen. Ich radle und mache etwas Fitnesstraining. Entdeckt habe ich die alten Kirchen in Europa, dafür fahre ich auch hin und wieder ein wenig umher. Sie waren ja auch in der Pandemie-Zeit meist offen. Im Gegensatz übrigens zu den Restaurants während meiner Proben in Frankreich – ausgerechnet!
Nochmals in die gesangliche Zukunft: Gibt es Rollenwünsche für die kommenden Jahre? Vielleicht in Corellis Fußstapfen Andrea Chénier?
Oh ja, Chénier wäre etwas – und wenn der Name Corelli schon gefallen ist: diese Einspielung von „Adriana Lecouvreur“ mit ihm, Magda Olivero, Ettore Bastianini und Giulietta Simionato … wunderbar! Ich hatte übrigens bereits ein Angebot für diese Oper, aber mit nur zwei Wochen Proben, das fand ich nicht angemessen. Man muss wie in diesem epochalen Mitschnitt auf „Größe“ zielen und dem Komponisten sozusagen „Ehre erweisen“.
Und dann wartet der schwerere Verdi ja auch … Gibt es für die kommenden Jahre eine Richtschnur für Sie?
Einen Satz von Daniel Barenboim habe ich verinnerlicht: „Never let ambition cloud talent“ – lass nie deine Ambitionen über das hinausschießen und eintrüben, was und wo du bist. Sei dir immer ganz bewusst, wo du stehst.
Dieser Artikel ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe September/Oktober 2022