Stille ist das Lauteste in der Musik, davon ist Philippe Jordan überzeugt. Die Faszination geht von dem aus, was bei Mozart oder Puccini zwischen den Tönen zu hören ist
Begonnen hat der bekennende Zen-Buddhist seine steile Karriere bereits mit 19 Jahren am Theater Ulm. Es folgten drei Jahre als Generalmusikdirektor in Graz, elf Jahre als Musikchef der Pariser Oper und die Position des Chefdirigenten der Wiener Symphoniker ab 2014. Seit Beginn dieser Spielzeit ist Philippe Jordan mit gerade einmal 46 Jahren Musikdirektor im „Opern-Olymp“ – der Wiener Staatsoper.
Iris Steiner traf den Shootingstar zum Gespräch in Berlin. Was treibt ihn an, der nie ein Dirigierstudium absolvierte und nach einer Ausbildung zum Orchesterleiter auf Anraten seines Vaters Armin Jordan – selbst erfolgreicher Dirigent – lieber den Weg über die Praxis ging?
Die Position des Musikdirektors an der Wiener Staatsoper war in den letzten Jahren nicht besetzt. Warum jetzt und was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Die Basis eines jeden Opernhauses ist das Orchester und sein Dirigent. Wenn das im Laufe der Zeit eine Einheit wird und einen musikalischen Standard garantiert, wirkt es sich auf die Qualität jeder Aufführung aus, egal wie gut die Sänger auf der Bühne sind oder wie gut das Regiekonzept ist. Ich sage nicht, dass es nicht auch ohne Musikdirektor geht, aber wenn es ihn gibt, ist er ein ganz entscheidendes Fundament für ein Opernhaus. Barenboim, Levine, Thielemann, Petrenko – alles gute Beispiele dafür, wie sehr man die Handschrift eines Hauses auch mit der des Musikdirektors in Verbindung bringt. Bogdan Roščić und ich haben eine gemeinsame Vision entwickelt, wie man das Profil der Wiener Staatsoper in Zukunft gestalten kann. Inhaltlich legen wir großen Wert auf das, was man die „Wiener Hausheiligen“ nennt. Das war und ist die Grundlage und das Zentrum des Hauses – von den Premieren bis zu den Repertoirevorstellungen. Puccini, Strauss, Mozart, Wagner, Verdi – darum müssen wir uns kümmern und darauf können wir aufbauen.
Warum haben Sie gerade die „Madama Butterfly“ als Wiener Eröffnungspremiere gewählt
Es war die Grundidee von Bogdan Roščić, das Repertoire mit zehn beispielhaften Inszenierungen und wichtigen Stücken, die er an das Haus bringen möchte, zu erneuern. Die bis jetzt aktuelle „Butterfly“ von Josef Gielen war die älteste existierende Produktion im Repertoire und gleichzeitig eine, die erneuert werden sollte, allein schon weil das, was übrig war, mit den ursprünglichen Intentionen nichts mehr zu tun hatte. Für mich war von Anfang an klar, dass ich als Musikdirektor diese erste Premiere machen muss. Außerdem liebe ich Puccini und habe einen speziellen Zugang zu dem Werk.

Was genau meinen Sie damit?
Ich habe als Jugendlicher in Zürich zum ersten Mal die „Butterfly“ in der Inszenierung von Werner Herzog gesehen und konnte dem Stück zunächst nicht viel abgewinnen – es war mir einfach zu viel „japanischer Realismus“, wenn man das so nennen darf. Einen Zugang habe ich erst später gefunden in der Produktion von Francesca Zambello in Genf, dirigiert von meinem Vater. Die Geschichte wurde szenisch umgedreht und in die amerikanische Botschaft verlegt, musikalisch verhalf mein Vater der Musik zu der ihr eigenen Sensibilität. Da wurde mir klar, dass es nicht darum geht, jedes Schirmchen und Teebecherchen ganz genau darzustellen und westlichen Darstellergesichtern möglichst gutes japanisches Make-up zu verpassen. Puccinis musikalische Farbenspiele erinnern beinahe schon an Debussy, die „Butterfly“ ist kein japanischer Verismo, sondern eine Tuschezeichnung, die mit Farben auf der Bühne genauso spielt wie mit den Orchesterfarben. Ohnehin ist Puccini im Vergleich zu Giordano oder Mascagni nie ein wirklicher Verist gewesen, man hat schon früh gemerkt, dass er viel weiter „hinaus“ blickt. Die Orchestration erinnert an Wagner und die Verbundenheit mit Lehár ist ebenfalls offensichtlich. Mit „Manon Lescaut“ und „La Bohème“ hat er sich dann eindeutig dem französischen Impressionismus zugewandt, bei der „Butterfly« ist diese tonmalerische Exotik noch viel stärker und ganz eindeutig hörbar – man darf sich nur nicht in Details verstricken.
Sie dirigieren Puccini sehr filigran und ungewohnt durchsichtig und verschaffen den Zuhörern damit durchaus neue Hörerfahrungen …
Ich würde Begriffe wie Transparenz, Klarheit und Homogenität wählen. Ich möchte jede Musik – auch und gerade die lauten Stellen – aus ihrer Stille heraus entwickeln und eine neue Balance finden, damit sie ihr volles Potential entfalten kann. Bei der „Butterfly“ geht es mir um den impressionistischen Einfluss in der Komposition, etwas, das gerade dieses Werk – bei aller Ähnlichkeit und Melodienseligkeit – von den Operetten Lehárs unterscheidet. Es ist davon abgesehen auch keine japanische „Tosca“ – Puccini hat sehr wohl gesehen, was Debussy und Janáček in dieser Zeit gemacht haben. Er suchte auf seine Weise nach neuen Mitteln für eine harmonische Weiterentwicklung ins 20. Jahrhundert. Man hört das, wenn auch nicht extrem, beispielsweise beim unaufgelösten Schlussakkord.

So gesehen geht Ihre nächste Produktion an der Staatsoper, die musikalische Neueinstudierung des „Rosenkavalier“ im Dezember, den Weg ins 20. Jahrhundert weiter. Es ist bereits Ihr zweiter „Rosenkavalier“ in Wien nach 2005. Was möchten Sie diesmal anders machen?
Damals war dieser Einspringer für Christian Thielemann mein zweiter „Rosenkavalier“ überhaupt. Zuvor hatte ich das Stück nur ein einziges Mal in Berlin im Jahr 2000 gemacht und bekam fünf Jahre später diese Chance, mich in immerhin drei Proben mit dem Orchester der Wiener Staatsoper und dem Werk vertraut zu machen. Ich habe damals sehr viel vom Orchester gelernt über die Art und Weise, wie sie Strauss spielen, und deren virtuosen Umgang mit Tempi und Rubati – bei Strauss grundsätzlich sehr wichtig. Nicht zuletzt diese Erfahrung hat den „Rosenkavalier“ in Paris zu meinem Erfolgsstück gemacht und war wahrscheinlich der Auslöser, mir dort die Chefposition anzubieten. Jetzt, fünfzehn Jahre später und sechs oder sieben „Rosenkavalier“-Produktionen weiter, kann ich das Stück mit mehr Erfahrung noch einmal angehen. In einem Brief an Willi Schuh beschreibt Richard Strauss seine musikalische Werksidee sehr klar: „Leicht will ich’s machen“ und an anderer Stelle: „Mozart, nicht Lehár“. Diese Leichtigkeit stelle ich diesmal in den Mittelpunkt meiner Arbeit und erarbeite zusammen mit dem Orchester das, was ich im Sinne Strauss’ dahinter vermute.
Sie bezeichnen den Rosenkavalier als „Herzensangelegenheit“. Was fasziniert Sie und warum nennen Sie es „eines der schwierigsten Werke überhaupt“?
Das Stück ist auf vielerlei Weise außergewöhnlich, es ist nicht ganz einfach, dem gerecht zu werden: Symphonisch mit einer auf die Spitze getriebenen Walzerseligkeit, dazu kontrastierende kammermusikalische Teile und dieser wunderbare Text von Hofmannsthal, den ich für einen der schönsten Operntexte überhaupt halte. Das Staatsopernorchester spielt Walzer wie kein anderes Orchester auf der Welt und ist mit seiner unglaublichen Opernroutine in der Lage, Stimmungen auf der Bühne sofort aufzunehmen. Großartige Voraussetzungen! Ich möchte mit den Sängern langfristig daran arbeiten, dem Orchester eine Vorgabe zu präsentieren, die ich für das halte, was Strauss und Hofmannsthal wollten. Das betrifft auch die Charaktere auf der Bühne. Ein gutes Beispiel ist die Figur des Ochs, der ursprünglich als durchaus positiver Don Juan vom Lande mit einer gewissen Erotik angelegt war, die abgesehen vom dritten Akt auch knistern darf. Mit Günther Groissböck haben wir eine Idealbesetzung für genau diesen Typus.
Sie mögen keine Regiekonzepte, die Produktionen zu Installationen oder reinen Bilderfluten verkommen lassen. Haben Sie deshalb kein Problem damit, dass der „Rosenkavalier“ „nur“ eine musikalische Aufarbeitung erfährt?
Die Inszenierung von Otto Schenk aus dem Jahre 1968 ist eines der großen und vom Publikum sehr geliebten Repertoire-Schlachtrösser. Ein Haus wie die Wiener Staatsoper will reformiert, nicht revolutioniert werden. Ein neuer Kurs hat durchaus auch Risiken und Neuerungen müssen gut dosiert sein, um das Publikum nicht vor den Kopf zu stoßen. Es kann gut sein, dass wir eines Tages einen neuen „Rosenkavalier“ machen, wenn sich ein ideales Team dafür findet. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, die bestehende Vorlage neu zu beleben. Generell bin ich kein Freund von Produktionen, bei denen man die Geschichten bis zur Unkenntlichkeit verfremdet, das stimmt. Dabei geht es mir nicht darum, in welcher Zeit oder in welchem Gewand die Handlung spielt, wenn es aus dem Stück heraus stimmt. Aus Erfahrung weiß ich aber mittlerweile, dass man manchmal im Sinne der Musik auch Grenzen bei dem einen oder anderen Regiekonzept ziehen muss.

Sie wünschen sich mehr und bessere Zusammenarbeit zwischen musikalischem Leiter und Regisseur bei der Erarbeitung eines Werkes. Woran krankt es denn momentan?
Ich möchte dem komplexen Anspruch der Kunstgattung Oper gerechter werden und habe den Traum, dass man im Sinne des bestmöglichen Ergebnisses auf Machtkämpfe verzichtet und glückliche Arbeitsbeziehungen zwischen Regisseur und Dirigent etabliert. Es ist übrigens auch nicht so, dass es die gar nicht gäbe – meine Begegnung mit Barrie Kosky bei den „Meistersingern“ in Bayreuth ist dafür ein gutes Beispiel. Daraus ist jetzt für Wien ein neuer Da-Ponte-Zyklus gewachsen, auf den man sich freuen kann.
Sie bezeichnen das Musiktheater als Ihre Lieblingsdisziplin und gelten als herausragender Stimmen-Kenner. Ihr Vater Armin Jordan war ebenfalls ein bedeutender Dirigent. Haben Sie diese Liebe für die Oper von zuhause mitbekommen?
Man muss sich auf dieses Abenteuer mit allen Komplexitäten einlassen. Sicher habe ich schon früh gesehen, was Theater ausmacht, und den Weg ganz bewusst geplant und gewählt – auch weil ich meinen Vater in seinem Beruf von klein auf beobachten konnte. Ich wollte Dirigent werden und das lernt man am besten im Orchestergraben, wo man dann auch durchschnittlich 60 Prozent seines Berufslebens verbringt. Es ist manchmal ein hartes Brot, aus dem trockenen Graben eines Opernhauses schöne Klänge hervorzuzaubern. Aber das Staatsopernorchester ist das beste Beispiel dafür, welche Qualität man erreichen kann, wenn man jeden Abend die Herausforderung zu meistern hat, ein großes Repertoire mit hoher Flexibilität auf sehr hohem Niveau zu spielen.
Sie legen großen Wert auf Textgestaltung und Textverständlichkeit im Sinne der Sprachlogik und auf den Zusammenhang zwischen Sprachklang und Klangbild der Musik. Warum messen Sie der Sprache einer Oper so große Bedeutung zu?
Sprache ist die erste Musik. Der Klang der Musik und der Klang der Sprache, in der die Oper geschrieben wurde, bildet oft eine klangliche Einheit, die besonders gut zum Tragen kommt, wenn die Sänger die Originalsprache gut beherrschen. Das überträgt sich dann auch positiv auf das Orchester. Ich persönlich mache zum Beispiel kaum russische Oper, obwohl ich sie liebe – weil ich die Sprache nicht kann. Auf welcher Basis sollte ich da mit den Sängern an den Phrasierungen arbeiten, wenn ich es nicht mal aussprechen kann!
Die Beschäftigung mit allen Musikstilen ist für Sie eine Grundlage des Dirigenten-Berufes. Was ist falsch am Spezialistentum?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man seinen Horizont nur dann wirklich erweitert, wenn man sich nicht spezialisiert. Als junger Dirigent macht man zu Beginn einer Karriere normalerweise viel Mozart und ist dabei sehr bemüht, jedes Detail zu gestalten. Nach diversen „Ring“-Erfahrungen hat sich mein Mozart-Dirigat total verändert, ich habe gelernt, viel großflächiger zu disponieren, was der Mozart’schen Musik zugute kommt … und umgekehrt. Solche Erfahrungen profitieren und bereichern sich gegenseitig. Ich fände es schade, diese Chancen nicht zu nutzen.
Gerade eben ist ein Buch über Sie erschienen, das nicht von ungefähr „Der Klang der Stille“ heißt. Was macht ausgerechnet Stille zum entscheidenden musikalischen Moment?
Das eigentlich Magische eines Moments ist die Stille, in die das Geschehen eingebettet ist. Musik macht Stille erst erlebbar und ist Voraussetzung für die Aufmerksamkeit, diese Stille wahrzunehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Musik wurde geradezu dafür geschrieben, damit man diese Stille wieder wahrnehmen kann – wobei es ganz verschiedene Formen von Stille gibt: Beim Fade-out zum Beispiel wird sie lauter, je leiser der Ton wird. Pausen können einen unglaublichen Raum einnehmen und eine Spannung erzeugen, die stärker wirkt als ein Fortissimo. Die Kunst besteht darin, diese Stille zu agieren. Das macht Puccini übrigens meisterhaft. In der „Bohème“ beim Tod von Mimi hat er direkt danach eine „lunga pausa“ komponiert – die leider kaum jemand macht. Dabei ist sie so wichtig vor dem großen Akkord. Wenn man da den Moment abwartet, ist die Wirkung so viel größer!
In dieser Zeit darf natürlich eine Frage nicht fehlen: Wie gehen Sie mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie um? Gerade der Kulturbetrieb steht ja ziemlich mit dem Rücken an der Wand …
Ich halte es für mittlerweile total unverhältnismäßig. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen – in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ist es völlig normal, dicht nebeneinander zu sitzen, nur bei Kulturveranstaltungen wird das viel strenger gehandhabt. Das macht einen wütend. Die inhaltliche Begründung, woher diese besondere Bedrohungslage gerade dort kommen soll, fehlt aber. Wir haben an der Wiener Staatsoper so gut es geht und mit großem Aufwand versucht, so viel Normalität wie möglich zu bewahren. Es war ja am Anfang ganz lustig, was alles im Internet gestreamt wurde und wie viel Kreativität man beobachten konnte – aber auf Dauer ist das natürlich kein Ersatz. Als wir mit den Wiener Symphonikern im Juni eine Beethoven-Sinfonie spielten – vor 100 Leuten im quasi leeren Saal, aber immerhin – und man das Resonieren eines Kontrabasses spüren konnte, war das damals ein großartiges Gefühl. Zusammen mit Menschen Musik zu machen und in die Gesichter eines „richtigen“ Publikums zu schauen, ist unersetzbar.
Ist es nicht eine Gefahr für das Genre Oper, wenn in vielen Häusern höchstens 200 Leute im Publikum sitzen dürfen? Braucht es nicht den Applaus und den Jubel, um Spannung und Emotionen zu entladen?
Es ist natürlich ein bisschen irritierend, aber in manchen Situationen habe ich eine beinahe „heilige“ Aufmerksamkeit wahrgenommen, die man nicht mehr hat, wenn das Auditorium brechend voll ist. Die Dankbarkeit des Publikums war förmlich spürbar und diese laute Aufmerksamkeit dann fast noch schöner als danach der dankbare Applaus. Aber das Ziel muss natürlich sein, so schnell wie möglich in vollen Besetzungen vor vollen Häusern zu spielen; alles andere kann nur ein Übergang dazu sein.
Empfehlung
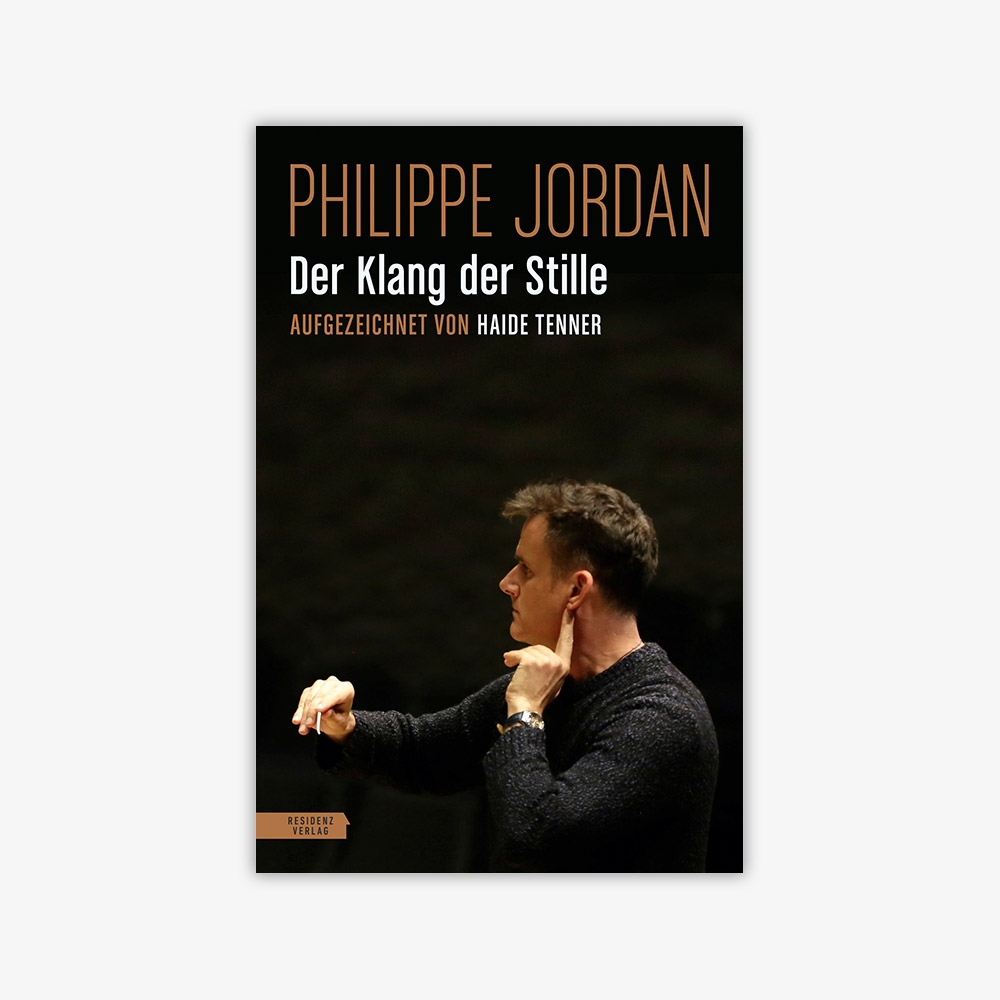
Der musikalische Lebensweg eines der gefragtesten Dirigenten seiner Generation, aufgezeichnet von Haide Tenner.
Erschienen am 25.08.2020 im Residenz Verlag.








