Category: Beiträge 2025
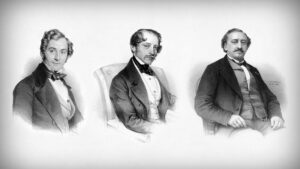
Die Altmeister des Komischen
Einst viel gespielt, heute fast vergessen: Gedanken zur Geschichte des heiteren Musiktheaters


„Die Nähe des Todes hat viel mit Oper zu tun“
In Chemnitz wird der DDR-Kultroman „Rummelplatz“ zur Oper

Zum Beispiel: Chicago
Missy Mazzolis „The Listeners“ an der Lyric Opera zeigt, wie „Oper der Zukunft“ aussehen könnte. Und wie man sein Publikum für moderne Kompositionen begeistert


Ich brauche Freiheit!
Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber lebt seinen Künstlertraum – zwischen Wien und Hamburg, zwischen Familie, Berufung,
Herkunft und Identität
Archiv
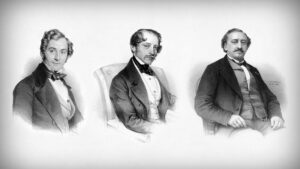
Die Altmeister des Komischen
Einst viel gespielt, heute fast vergessen: Gedanken zur Geschichte des heiteren Musiktheaters


„Die Nähe des Todes hat viel mit Oper zu tun“
In Chemnitz wird der DDR-Kultroman „Rummelplatz“ zur Oper

Zum Beispiel: Chicago
Missy Mazzolis „The Listeners“ an der Lyric Opera zeigt, wie „Oper der Zukunft“ aussehen könnte. Und wie man sein Publikum für moderne Kompositionen begeistert


Ich brauche Freiheit!
Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber lebt seinen Künstlertraum – zwischen Wien und Hamburg, zwischen Familie, Berufung,
Herkunft und Identität