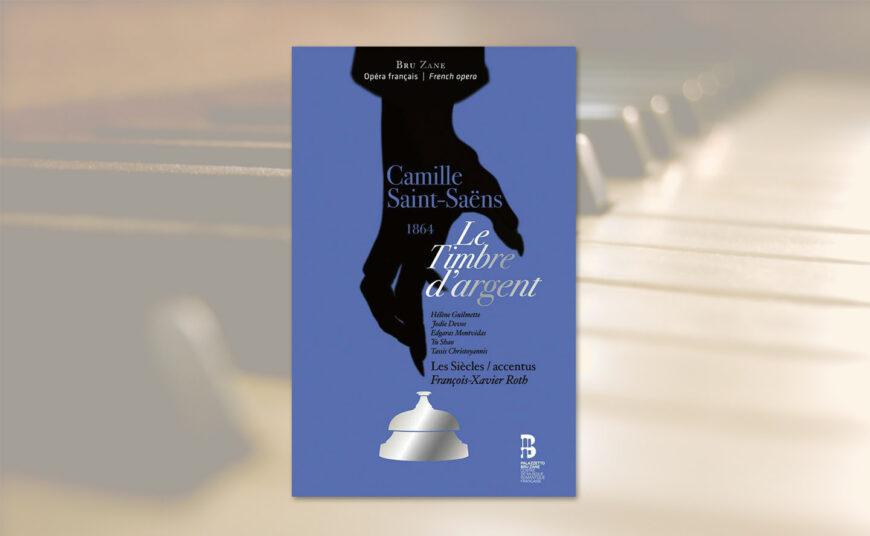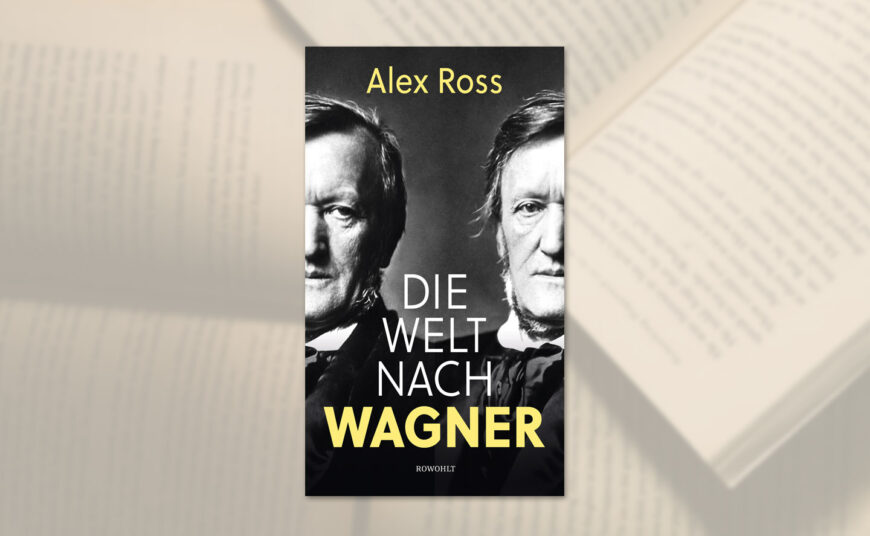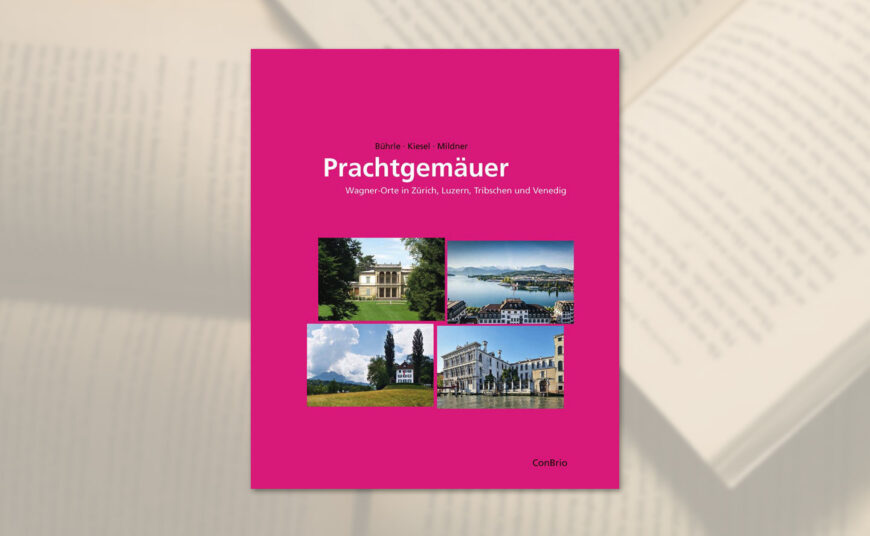Jaromír Weinberger: „Frühlingsstürme“
Entdeckerfreude und Wiedergutmachung – wen letzteres misstrauisch macht: Barrie Kosky steht ja grundsätzlich für theatralisch unterhaltsame „Stürme“ – und auch für Ausgrabungen von Berliner Erfolgen. Hier geht es um die am 20. Januar 1933 letzte glamouröse Operetten-Premiere im Admiralspalast vor der „Machtergreifung“ am 30. Januar. Vierzig Tage später wurde das gefeierte Werk des jüdischen Komponisten Jaromír Weinberger abgesetzt und verboten.
Damals sangen die bildschöne Jarmila Novotna und Star-Tenor Richard Tauber. Jetzt ist Vera-Lotte Boecker eine überzeugende Diva und reiche russische Witwe Lydia mit strahlendem Sopran. Seine türkische Abstammung kann Tansel Akzeybek in einen Hauch von „Osten“ für den japanischen Diener-Spion Ito verwandeln, vor allem aber besitzt er einen mühelosen Tenor mit glasklarer Artikulation. Er ist der Störfaktor im Schwarm russischer Garde-Offiziere um die begehrte Frau, die der amüsant alltags- und liebes-trottelige General Katschalow unbeirrt liebt. Doch militärisch gewieft gibt er für den im Hintergrund heraufziehenden russisch-japanischen Krieg von 1905 über Lydia falsche Informationen weiter, mit denen sie dem in einem großen Duett halb-und-halb geliebten Ito zur Flucht verhilft. Monate später treffen alle bei Friedensverhandlungen im Drehtür-Wirbel des Nobelhotels von San Remo aufeinander. Diplomat Ito hat geheiratet und singt Lydia nun wehmütig „Du wärst die Frau für mich gewesen“ hinterher. Sie rettet die durch die Ito-Flucht beschädigte Ehre von Katschalow und gibt ihm ihr Ja-Wort. Nebenbei sind seine Tochter Tatjana samt deutschem „rasenden Reporter“ Roderich durch die Szenen getaumelt-stolpert-küsst und dürfen nun auch ein Paar werden.
Für all das hat Weinberger eine mal kess bunte, mal emotional schwelgerische Mischung von großem Orchester mit jazziger Tanz-Band geschrieben, was Dirigent de Souza wie edlen Boulevard-Schampus serviert. Doch reizvoll „anders“ klingt und wirkt, dass sich fast operntragisch Tenor und Sopran nicht kriegen und die Absurdität allen Kriegs als fataler Hintergrund aufscheint – über alle Heimlichkeiten und Pistolen-Spiele hinweg dürfen Filmfreunde an Lubitschs unsterbliches „Sein oder Nichtsein“ denken. So wirkt auch der fast bühnengroße Militär-Truhenkoffer (Bühne: Klaus Grünberg) zunächst befremdlich düster, ehe er sich mal zum Boudoir oder zur erinnerungsseligen Show-Treppe für ein Folies-Bergère-Feder-Boa-Ballett (herrliche Choreographie-Vielfalt: Otto Pichler) auffächert. Durch Barrie Koskys turbulenten Mix hindurch ist einem der Theater-Lorbeer zuzuwerfen: Schauspieler Stefan Kurt mischt in der Sprechrolle des Generals Katschalow nicht nur Militärsteife mit Männerstolz und liebesblinder Trotteligkeit, er bewegt sich rhythmisch genau mit allen singend-tanzenden Partnern, bringt genau getimt seine melodiös eingefärbten Texteinwürfe – und dann gipfelt seine Liebesverzweiflung in einer abgründigen Parodie von Lenskis todesverschatteter Abschiedsarie „Wohin, wohin bist du entschwunden“. Da berühren sich wie in aller großen Kunst Tragödie und Komödie – und verdienen ein „Stupendo! – Bravo!“ All das zusammen brachte der reizvollen Aufzeichnung soeben den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ein.
Wolf-Dieter Peter
INFOS ZUR DVD/BLU-RAY
Jaromír Weinberger: „Frühlingsstürme“ (1933)
Kurt, Sadé, Boecker, Köninger, Akzeybek, Lindenberg u.a.
Jordan de Souza (Dirigat), Barrie Kosky (Inszenierung)
Chor und Orchester der Komischen Oper Berlin
1 DVD/Blu-Ray, Naxos