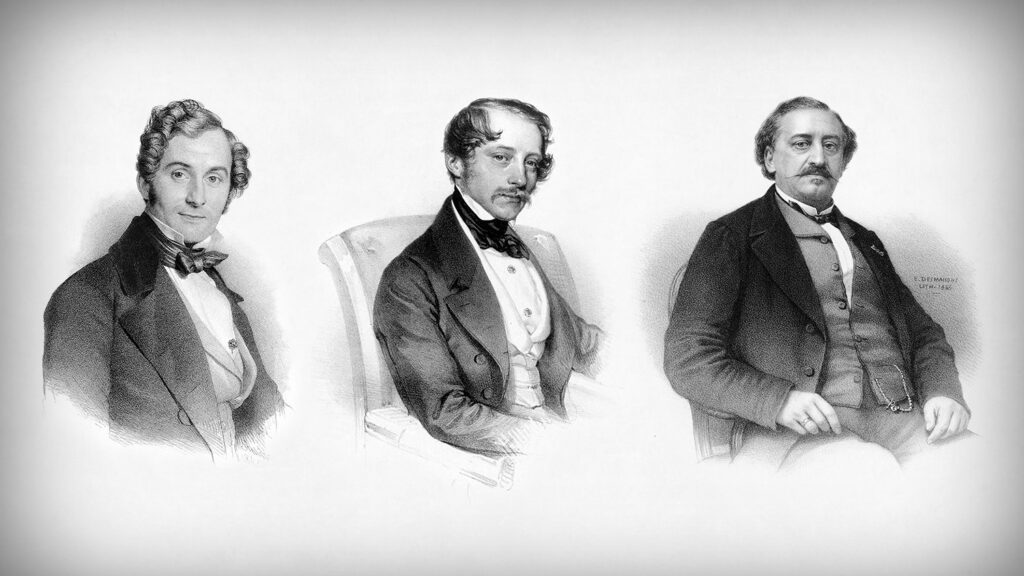Im Gespräch mit Barbara Hannigan
Ihr Markenzeichen: die Doppelrolle als Sängerin und Dirigentin. Das Stück: die Monooper „La voix humaine“ von Francis Poulenc, mit der sie seit über zehn Jahren auf der ganzen Welt für Furore sorgt, zuletzt in Erl. Wir sprachen mit der kanadischen Sängerin und Multikünstlerin – über neue Herausforderungen, spontane Entscheidungen und die „Kunst“, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden
Interview Simon Chlosta
In diesem Jahr sind Sie mit dem Polar Music Prize ausgezeichnet worden, einem der wichtigsten Preise für klassische Musiker. Einerseits sicher eine große Ehre, andererseits klingen solche Preise immer auch ein bisschen nach „Lebenswerk“. An welchem Punkt Ihres Lebens oder ihrer Karriere sehen Sie sich aktuell?
Ich hatte zunächst denselben Gedanken, als ich davon erfuhr: Ist das jetzt schon ein Preis für mein Lebenswerk? Ich habe doch noch 30 Jahre vor mir, warum geben sie ihn mir jetzt? Aber dann haben mich die Organisatoren beruhigt und gesagt, auch wenn der Preis oft erst an Menschen am Ende ihrer Karriere vergeben wird, steht er einfach für das, was ich bisher erreicht habe. Und da sind ja so viele Aspekte: das Singen, das Dirigieren, meine Arbeit als Mentorin. Ich habe auf jeden Fall noch viel zu tun und viele Ideen!
Welche zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Komponistinnen und Komponisten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann werde ich ja ab der Saison 2026 auch Chefdirigentin beim Island Symphony Orchestra. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, denn obwohl ich jetzt schon zehn Jahre Erste Gastdirigentin in Göteborg und neuerdings auch in Lausanne bin und außerdem eng mit Orchestern in London, München und Kopenhagen zusammenarbeite, war ich bislang noch nirgendwo Künstlerische Leiterin. Das ist etwas ganz anderes und eine große Verantwortung für mich, die ich gerne annehme, um zu sehen, wohin sie mich führt.
Haben Sie denn schon konkrete Pläne mit ihrem neuen Orchester?
O Gott, ja, jede Menge Pläne. Viel zu viele! Ich war letztes Jahr schon dreimal dort und habe viel mit ihnen telefoniert, um das künftige Programm zu planen. Die erste Saison ist jetzt im Grunde genommen fertig, wir müssen nur noch die Programme für die Gastdirigenten und -künstler festlegen. Das ist sehr viel Detailarbeit, da muss man einfach immer am Ball bleiben, man kann das nicht einfach delegieren. Aber ich bin da sehr engagiert. Ich arbeite parallel auch schon an meiner zweiten Saison und überlege mir, wie ich unsere Präsenz in Island und auf internationaler Ebene gestalten möchte.
Ist es eigentlich manchmal nervig, so weit im Voraus zu planen? Sie müssen ja heute schon wissen, worauf Sie in zwei oder drei Jahren Lust haben und was Sie singen oder dirigieren wollen? Wäre man da nicht manchmal gern etwas spontaner?
Stimmt schon, wir planen sehr weit im Voraus, was manchmal frustrierend sein kann. Andererseits habe ich es geschafft, auch innerhalb dieser langfristigen Strukturen Raum für Spontaneität zu schaffen. Ich kann also immer noch Programme ändern, Dinge hinzufügen und meine Kollegen anrufen und sagen: „Hey, lasst uns dies oder jenes machen.“ Ich schätze mich daher sehr glücklich.

Um noch einmal kurz zurückzublicken: In der vergangenen Saison haben Sie gleich mehrfach „La voix humaine“ von Francis Poulenc aufgeführt, zuletzt bei den Tiroler Festspielen in Erl. Diese Monooper, in der sich eine Frau am Telefon von ihrem Geliebten trennt, begleitet Sie schon sehr lange, auch in der nächsten Saison steht sie wieder in ihrem Kalender. Was ist so besonders an diesem Werk, dass Sie es immer wieder aufführen?
Ja, ich singe diese Partie jetzt schon seit mehr als zehn Jahren. Die Handlung ist schnell erzählt, aber der Kern des Stückes ist natürlich ein anderer. Es geht es um Liebe und Verlust, um Isolation und die Angst, allein zu sein. Der Text von Jean Cocteau, den Poulenc vertont hat, ist einfach unglaublich, weil er einem so viel Dramaturgie bietet, mit der man sich auseinandersetzen kann – und weil die Figur ständig darüber spricht, was wahr ist und was eine Lüge. Neulich hat mir jemand nach einer Aufführung gesagt: „Eine Lüge ist sehr einfach, und die Wahrheit ist unglaublich komplex.“ Und ich dachte: „Oh, das ist ein wirklich guter Satz, denn so ist der Mensch irgendwie.“ Und so darf man auch nicht alles, was die Frau sagt, für wahr halten. Das macht es so interessant.
Sie haben das Stück auch schon selbst dirigiert und dabei gleichzeitig den Part der Frau gesungen, umgeben von Videoleinwänden, auf denen Sie selbst zu sehen sind …
Ja, das ist die Version, die ich am häufigsten aufführe, weil sie sehr gefragt ist. Allein in der nächsten Saison werde ich sie in New York, Prag, Istanbul und in der Scala in Mailand aufführen, immer mit verschiedenen Orchestern. Es ist wirklich eine besondere Version, weil sie das Stück auf eine andere Ebene hebt. Und bisher gab es auch noch nie etwas Vergleichbares, bei dem die Dirigentin die gesamte Oper singt und über drei im Orchester platzierte Videokameras mit den Live-Bildern interagiert. Die Umsetzung war 2021 eine große Herausforderung, aber auch sehr spannend – und sie ist bis heute eine kraftvolle und emotionale Art der Darbietung geblieben.
Klingt nach einem perfekten Barbara-Hannigan-Stück! Haben Sie manchmal das Gefühl, dass ein Werk, auch wenn es schon etwas älter ist, so gut zu Ihnen passt, als wäre es gerade erst für Sie geschrieben worden?
Eigentlich fühlt sich jedes Stück, das ich aufführe, für mich wirklich neu an, auch wenn es von Berlioz oder Beethoven ist. Der Grund dafür ist, dass ich immer von der Partitur ausgehe und mich nicht nach bestimmten Aufführungstraditionen richte, die durch andere Interpreten bekannt geworden sind, ganz gleich, ob es sich um eine Uraufführung oder um ein Barockstück handelt. Ich habe schon mit so vielen Komponisten zusammengearbeitet, und auch sie lenken mich immer wieder zurück zur Partitur und nicht etwa zu der Art und Weise, wie es der letzte Sänger oder Dirigent möglicherweise interpretiert hat. Niemand sagt mir, dass ich es so singen soll, wie es jemand anderes getan hat oder wie es auf dieser oder jener Aufnahme zu hören ist. Die Komponisten halten sich an ihre Partitur, also tue ich das auch.
Kommen wir noch einmal auf Ihre Doppelrolle als Sängerin und Dirigentin zu sprechen. Hat sich da in den vergangenen Jahren etwas geändert in Bezug auf das Verhältnis oder der Balance zwischen diesen beiden Professionen?
Als ich mit dem Dirigieren anfing, hatte ich eine Vollzeitkarriere als Sängerin, da blieb also nicht viel Zeit dafür. Dann wurde es irgendwann 50/50, und schon bald waren es eher 75 Prozent Dirigieren und 25 Prozent Singen. Ich habe mich dann sehr bemüht, nicht auch bei jedem Dirigierprogramm zu singen, teils, um meine Stimme zu schonen, teils weil ich nicht immer nur die singende Dirigentin sein wollte. Im letzten Jahr ging es nun wieder mehr in Richtung Singen, und mir wurde auch klar, dass jetzt alle wissen, dass ich beides kann und ich nichts mehr beweisen muss. Jetzt ist es wieder einigermaßen ausgeglichen und das finde ich großartig. In der kommenden Saison habe ich auch wieder viel Gesang im Programm, darunter eine große Tournee mit meinem Klavierpartner Bertrand Chamayou, aber auch, wenn ich mit Orchestern auftrete. Es gab bestimmte Stücke, die ich unbedingt aufführen wollte, also habe ich die Orchester einfach angerufen und gesagt: „Wir müssen das Programm ändern.“ So viel zum Thema Spontaneität: Es geht also, wenn man will!

Könnten Sie sich auch vorstellen, irgendwann nur noch zu dirigieren? Immerhin werden Dirigenten ja oft sehr alt, während die Bühnenkarriere einer Sängerin begrenzt ist.
Wenn ich das vor zwei Jahren gefragt worden wäre, hätte ich gesagt: „O ja, auf jeden Fall werde ich irgendwann mit dem Singen aufhören.“ Jetzt habe ich sehr gemischte Gefühle dabei, weil ich denke, dass die Entscheidung, dass eine Stimme nicht mehr hörenswert ist, eine sehr große Entscheidung ist – sowohl für das Publikum als auch für die Person selbst. Und schauen wir uns Sängerinnen wie Joni Mitchell an, die immer noch singt, obwohl sie sogar einen Schlaganfall hatte. Sie hat ihre Stimme durch das Singen zurückgewonnen, wenn auch nicht mehr das ganze Register, aber die Leute wollen sie hören. Natürlich kann ich in zehn Jahren wahrscheinlich keine Lulu mehr singen, aber bestimmt wird es etwas anderes für mich geben. Ich denke also, wenn ich singen will, sollte ich singen.
Neben Ihrer Arbeit als Sängerin und Dirigentin sind Sie auch als Lehrerin und Mentorin sehr aktiv. Sie geben Meisterkurse und haben sogar Ihr eigenes Förder-Programm „Equilibrium“, mit dem Sie junge Musikerinnen und Musiker auf eine Solistenkarriere vorbereiten. Außerdem kehren Sie als „Juilliard Creative Associate“ an die Juilliard School in New York zurück. Was genau werden dort Ihre Aufgaben sein? Gibt es den einen speziellen Tipp, den Sie all Ihren Studenten mitgeben?
Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sich selbst treu zu bleiben. Aber das muss eine bewusste Authentizität sein, es geht nicht um Narzissmus oder um „Ich, ich, ich“. Es geht eher um die innere Wahrheit, und das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir mit der Musik umgehen, wie wir unseren Körper als Instrument einsetzen, wie wir eine physische Verbindung zur Musik aufbauen. Ich übe mit den Musikern zum Beispiel immer die Atmung, nicht nur mit Sängern, auch mit den Orchestern rede ich viel darüber. Ja, Atmung ist für jeden Musiker wichtig.
Haben Sie eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, zu komponieren? Immerhin haben Sie in diesem Jahr ein Werk für das Verbier Festival mit dem Titel „At the Fair“ arrangiert.
Ja, das war zwar ein Arrangement, es gab aber auch komponierte Teile darin. Vor langer Zeit habe ich sogar mal Kompositionsunterricht gehabt, allerdings nicht mit dem Ziel, Komponistin zu werden. In der Highschool habe ich dann eher aus pragmatischen Gründen gelernt, wie man Arrangements erstellt, weil wir Stücke aufführen wollten, für die wir weder die finanziellen Mittel hatten noch die Rechte an bestehenden Arrangements erwerben konnten. Ich war damals etwa 17 Jahre alt, und jetzt ist es ein bisschen so, als würde ich dorthin zurückkehren. Es macht mir Spaß, also mal sehen, was kommt!
Dieser Artikel ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe September/Oktober 2025