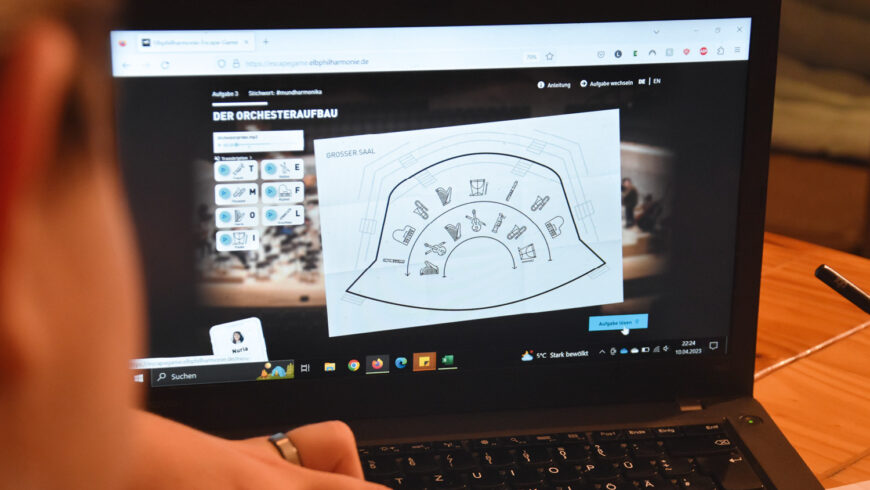Namibias erste und einzige Oper „Chief Hijangua“ feiert ihre Europa-Premiere in Berlin
von Antje Rößler
Mitte September kann das Berliner Publikum die erste namibische Oper überhaupt erleben. Genau genommen handelt es sich um eine deutsch-namibische Oper: „Chief Hijangua“ erzählt eine Geschichte aus dem kolonialen Deutsch-Südwestafrika. Der Komponist heißt Eslon Hindundu. Regie führt Kim Mira Meyer, die als Geschäftsführerin der Münchner Momentbühne das Projekt in die Wege leitete. Gesungen wird auf Otjiherero und Deutsch, auf der Bühne stehen Sängerinnen und Sänger verschiedener Hautfarben – aus Namibia, Südafrika und Deutschland.
Die Saat für diese einzigartige Produktion wurde 2019 beim Immling Festival im Chiemgau gelegt. Hier war Kim Mira Meyer als Regieassistentin tätig und Eslon Hindundu als Chorleiter aktiv. Die beiden hatten die Idee für ein gemeinsames Opernprojekt. „Das war eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, denn Oper ist auf dem afrikanischen Kontinent eine Seltenheit“, erzählt Hindundu. „Wenn ein Namibier eine Oper erleben will, muss er ins südafrikanische Kapstadt reisen. Meine Motivation war es, meinen Landsleuten die klassische europäische Musik zu zeigen und neue Möglichkeiten für namibische Musiker zu schaffen. Es gibt hier so viel musikalisches Talent, das aber verloren geht.“
Ein weiteres Ziel: das musikalische Erbe Namibias zu bewahren. „Unsere Musik ist nicht gut erforscht und dokumentiert“, erklärt der Komponist. „In letzter Zeit verliert sie an Bedeutung. In Schulen und im öffentlichen Leben werden die alten Volkslieder nicht mehr gesungen. Es besteht die Gefahr, dass wir dieses kulturelle Erbe verlieren. Mit der Komposition einer Oper wollte ich auch einen Teil unserer Musikgeschichte bewahren.“
Von Windhoek nach Berlin
Die Pandemie legte dem Projekt Steine in den Weg, doch schließlich ging im September 2022 die Uraufführung von „Chief Hijangua“ im ausverkauften Nationaltheater von Namibias Hauptstadt Windhoek über die Bühne. Es musizierte das semi-professionelle Namibian National Symphony Orchestra. Da es in Namibia keinen Operngesang gibt, wurden Solisten aus Südafrika engagiert. Die Chorsänger hat Eslon Hindundu, der in Südafrika studierte, persönlich in die Gesangstechnik eingewiesen. „Wir kombinieren den klassischen Operngesang mit der Art und Weise, wie die Namibier singen“, erzählt er. „Diese Mischung ist ganz erstaunlich. Wir haben einen tollen Klang erreicht.“ Auch mit der Resonanz auf die Aufführungen ist er zufrieden. „Bei mir haben sich anschließend mehrere namibische Sänger gemeldet, die in den USA, Südafrika oder Deutschland arbeiten. Sie wünschen sich mehr namibische Opern und möchten sich einbringen.“

Um die Produktion nach Deutschland zu bringen, wurde das Siemens Arts Program mit ins Boot geholt. In dessen noblen Räumlichkeiten am Berliner Gendarmenmarkt trafen sich die Beteiligten im Februar 2023 zu einem Konzeptions-Workshop, an dessen Ende eine deutliche Weiterentwicklung des Stücks stand. „In Namibia hatten wir eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt“, meint Hindundu. „Man konnte zwar die Schönheit des Ganzen erkennen. Aber als sich in Berlin das ganze Team jeden Aspekt noch einmal gründlich vornahm, haben wir aus dem Stück noch viel mehr rausgeholt.“
Mitte September 2023 läuft die Europa-Premiere im Berliner Haus des Rundfunks, es spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Eine Fassung für Kinder wird im Humboldt Forum gezeigt. Die Hauptrolle des Prinzen übernimmt der südafrikanische Bariton Sakhiwe Mkosana, der die Partie auch schon in Windhoek gesungen hat. Mkosana startete seine Karriere am Opernhaus von Kapstadt. Inzwischen ist er Mitglied des Opernstudios Frankfurt und hat mehrere Wettbewerbe gewonnen, darunter den zweiten Preis bei „Neue Stimmen“ 2022.
Namibische Mythen und afrofuturistisches Design
Die Handlung von „Chief Hijangua“ setzt sich aus Geschichten zusammen, die in Namibia über Generationen hinweg mündlich überliefert wurden. „Das Geschehen spielt sowohl in einem mythischen Zeitalter als auch irgendwann im 19. Jahrhundert in der realen Landschaft Namibias“, sagt Librettist Nikolaus Frei. „Die Erzählweise wirkt zugleich allegorisch und konkret.“ Bei Bühne, Kostümen und Maske vereinen sich europäische sowie traditionelle und zeitgenössische namibische Gestaltungselemente. Afrofuturistisches Design geht einher mit einer multimedialen Bereicherung durch die namibische Künstlerin Isabel Katjavivi.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein namibischer Prinz, der nach seiner Bestimmung im Leben sucht. Er ist in das schönste Mädchen seines Dorfes verliebt, das aber schon seinem älteren Bruder versprochen ist. Daher geht er in die Fremde, wo er allerlei Abenteuer erlebt und schließlich bei der Familie eines deutschen Missionars hängenbleibt. Obwohl er schließlich getauft wird, gibt es kein Happy End. „Mein erster Impuls war es, die brutale Kolonialgeschichte darzustellen – mit dem Anspruch, historische Aufarbeitung zu leisten“, erinnert sich Librettist Frei. Im Hinterkopf hatte er den Massenmord an den Herero, der unter der Kolonialherrschaft des Deutschen Reiches stattfand. „Doch je mehr ich Eslon zuhörte, desto klarer wurde mir: Eine Oper ist dafür nicht das richtige Genre.“ Nun lässt sich die Geschichte von „Chief Hijangua“ eher als eine allgemeine Allegorie auf den Kolonialismus lesen. Und Eslon Hindundu, der den englischen Part des Librettos in seine Muttersprache Otjiherero übersetzte, hat auch für eine Prise Herzschmerz und Liebesschmalz gesorgt. „Ich wollte den Stoff etwas würzen“, lacht er.
Ein ganz neues Opern-Idiom
Hindundu studierte Musik im südafrikanischen Bloemfontein und verdient sein Geld heute als Chordirigent in Windhoek. „Ich leite einen eigenen Chor, die Vox Vitae Singers, mit denen ich häufig bei Regierungsveranstaltungen oder in Firmen auftrete. Außerdem probe ich mit dem Chor meiner Kirche“, erzählt der 27-Jährige. „Als Vollzeitmusiker in Namibia zu überleben, ist sehr schwierig. Aus diesem Grund ist die namibische Musik auch nicht so entwickelt, wie sie es sein könnte. Viele Musiker geben auf, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können.“

Besonders kritisch war die Lage während der Pandemie, als Chorgesang verboten war. „Ich habe von der Regierung zumindest eine kleine Kompensation bekommen und die Zeit genutzt, ein halbstündiges Oratorium zu schreiben“, erzählt Hindundu, der einer freikirchlichen Pfingstgemeinde angehört und sich sehr für geistliche Musik aus Renaissance und Barock interessiert. Johann Sebastian Bach war eine Inspirationsquelle für seine Oper. „Bach nahm die alten Choräle und erweckte sie zu neuem Leben“, meint Hindundu. „Also dachte ich mir, ich könnte etwas Ähnliches mit den namibischen Gesängen anstellen.“ Ein ganz neues Opern-Idiom sei da entstanden, verspricht der Komponist: eine Verbindung zwischen klassischer europäischer Musik und traditionellen namibischen Elementen. „In der namibischen Musik gibt es typische Fünftonskalen, viele Off-Beats und Synkopen. All das hört man in der Oper.“
Hindundu setzt auf diatonische Harmonien, wie sie dem System von Dur und Moll zugrundeliegen und mit der Popmusik weltweit verbreitet wurden. So kann sich das Orchester am einfachsten einfügen; außerdem werden diese Klänge von allen Namibiern verstanden. „Die Problematik der Intonation war mir beim Komponieren sehr bewusst“, erklärt er. „Ich möchte in der vielfältigen multikulturellen Gesellschaft Namibias jeden erreichen. Buren, Deutschnamibier, Ovambo, Südafrikaner, Tswana: Alle dürfen sich angesprochen fühlen.“
Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit spielt für ihn keine vordergründige Rolle. Hindundu wirkt sogar ein wenig verwundert darüber, mit welcher Vehemenz sich die deutschen Partner damit beschäftigen. „In allen Gesprächen hier kommt dieses Thema auf“, erzählt er beim Treffen während des Berliner Workshops im Februar. Ihn beflügelt vor allem das gemeinsame Reden, Nachdenken, Musizieren. „Es begeistert mich, wie gut Namibier und Deutsche in unserem Team zusammenarbeiten.“
Dieser Artikel ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe Juli/August 2023