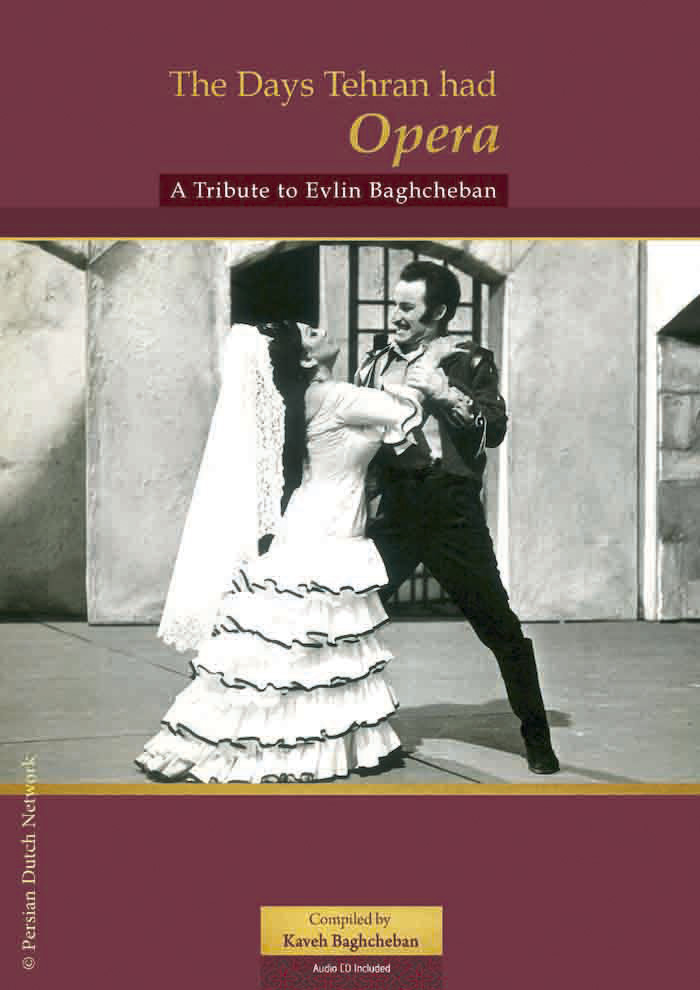Im Gespräch mit dem Theater-Architekten-Ehepaar Emanuela Hualla Achatz und Walter Achatz
Interview Iris Steiner und Dr. Wolf-Dieter Peter
Von „einstürzenden Neubauten“ muss nicht direkt die Rede sein, aber von der weltweit beneideten Infrastruktur: Eine steigende Zahl der über 80 derzeit bespielten Theaterbauten benötigt dringend eine grundlegende Sanierung und Renovierung, teils mit Umbau und Erweiterung – etwa von Berlin über Köln, Frankfurt und Darmstadt bis Stuttgart, von Coburg über Würzburg, Nürnberg bis Augsburg. Das Atelier Achatz in München ist dafür eine der renommierten Adressen: Das federführende Ehepaar kann auf die fertiggestellten Münchner Kammerspiele, das Cuvilliéstheater, das Gärtnerplatztheater und die derzeitigen Großbaustellen Augsburg und Darmstadt verweisen. Dabei ist das „Bauen“ nur ein Aspekt, der das Gespräch lohnt.
Müssen „Frau&Mann“ Oper und Theater lieben, um dafür und darin als Architekten tätig zu sein?
Walter Achatz: Kein „Muss“, aber wir sind beide profunde und langjährige Theaterliebhaber. Und es ist einfach schön, nicht an einem profitorientierten Projekt zu arbeiten, dafür aber meist mit den kreativen Menschen, die in diesen Bauten ja arbeiten, in Kontakt zu stehen. Und zum Endergebnis sage ich vielleicht am Schluss unseres Gespräches etwas …
Wir sprechen ja über aktuelle und kommende „Problem-Bauten“ und zunehmend gilt auch der Begriff „Nachhaltigkeit“.
Walter Achatz: Für unsere alten Theaterbauten, die nicht durch die beiden Kriege zerstört wurden, galt pauschal eine Nutzungsdauer von rund 100 Jahren. Das hat sich dann speziell auch durch die Entwicklung der Theatertechnik etwa auf 50 Jahre reduziert und derzeit geht man eher von höchstens 30 Jahren aus …
Emanuela Hualla Achatz: … dann erfordern hauptsächlich Brandschutz und Technik, aber auch die gesellschaftlichen Erwartungen und Ansprüche an so einen „kulturellen Fest-Raum“ eine weit- und dann oft weitergehende Überarbeitung.

In Architektur-Artikeln spukt dann neben der „Nachhaltigkeit“ der Begriff „Beton-Gold“, also die Nutzung der im Material vorhandenen Qualität.
Walter Achatz: Wir sprechen lieber von „grauer Energie“, die wir erneut nutzen können – bis zu einem bestimmten Maß. Denn allein der Brandschutz in diesen Gebäuden hat sich enorm ausgeweitet. Als Theaterfreund weiß man ja von diversen verheerenden historischen Bränden mit vielen Toten – bis hin zu den aktuellen Katastrophen in Clubs. Daher nur ein Satz: Für uns steht der bestmögliche Brandschutz ohne Diskussion an erster Stelle – also von Verhütung bis zur „Entfluchtung“. Viel öffentlichkeitswirksamer ist dann etwas zu lesen, wenn neue Licht-, Fahr- und Tontechnik in ein Theater eingebaut wird: Da ist meist einiges zu sehen und zu hören. Ein paar unsichtbare Fakten: Allein im Probengebäude der Münchner Kammerspiele mussten 640 km Elektro-Kabel verlegt werden, Vergleichbares im Gärtnerplatztheater. Dazu kommt die aufwendig gewordene Medientechnik, Ton und Video etc. Für die gesamte Haustechnik waren das im Gärtnerplatztheater vor der Sanierung rund 1.000 m2 Technik, jetzt mussten wir 4.000 m2 Platz schaffen.
Emanuela Hualla Achatz: Dazu kommen Anforderungen wie die „Betriebsoptimierung“ für den Theateralltag, von den Werkstätten bis zur Kantine; die Einlagerung der aktuellen Spielzeit sowie dann moderne Logistik zur eventuell unumgänglichen Auslagerung. Und das große Thema Barrierefreiheit: Das ist nicht nur eine schon länger formulierte Forderung der bayerischen Politik, es ist auch unter dem Gesichtspunkt „Inklusion“ zu sehen und dazu der Anspruch auf einen gewissen Komfort. Und schließlich der gesellschaftliche Aspekt: das Theater nicht nur abends, sondern auch tagsüber als Begegnungsstätte anzubieten, ohne den Probenalltag zu behindern.
Steht über allem nicht das Denkmalamt?
Walter Achatz: Ja, berechtigterweise, da vor allem die Werkstätten des Theaters im Alltagsbetrieb ohne größere Rücksprache und Rücksicht auf die vorhandene Substanz fleißig weitergebaut, oft gut gemeint zu optimieren und zu verbessern versucht haben – bis hin zu „Wildwuchs“ …
Grundsätzlich müssen doch Zuschauerraum, Lifte, Garderoben, Toiletten, Foyer, Orchestergraben, Bühnenraum, Probebühne, Technik, Werkstätten, Kantine, Chor- und Orchesterprobenräume, Fundus neu und erweitert „zusammengebaut“ werden.
Emanuela Hualla Achatz: Und speziell durch Corona sind die Anforderungen an den Komplex „Lüftung“ enorm gewachsen. Wenn im Theater Tänzer auftreten, müsste eigentlich aufgrund deren rein körperlicher Tätigkeit die Lüftung das Mehrfache leisten. Das ist oft baulich nicht umzusetzen und auch ein Kostenfaktor.

Einschub zum „Wir“: Wie fanden denn Architektin und Architekt zusammen?
Emanuela Hualla Achatz: Ich kam als Praktikantin in das Büro eines meiner damaligen Professoren, wo Walter als Werkstudent tätig war. Aber mit Figaro: „Il resto nol dico“ – „das Weit’re, das Weit’re verschweig’ ich“ … Zur Familie Achatz gehören mittlerweile zwei erwachsene Kinder.
Wie ist jetzt Ihr Arbeitsprozess? Der Herr für den Beton, die Dame für Innenausstattung, Farbe, Dekor – oder ist das zu banal rollentypisch?
Emanuela Hualla Achatz: Sehr gerne die Innenausstattung, auch mal das Intendantenzimmer, die Auswahl der Materialien und Farben – das alles in enger Abstimmung speziell mit der Denkmalpflege. So ist es uns etwa im Münchner Cuvilliéstheater gelungen, das historische Erscheinungsbild in den Foyers hochleben zu lassen, Neues einzufügen wie die Überkuppelung, die Theken und Garderoben – doch alles zu verbinden, sodass es ein Kontinuum gibt, das sichtbar und erlebbar wird. Einerseits ein „Da hat sich ja nichts geändert“, andererseits „Das ist aber neu und passt“. Und ansonsten bin ich hier die „Bodenstation“.
Walter Achatz: Zum weiteren Alltag unserer Arbeitsteilung: Ich mache überwiegend die Acquisition und die aktive Umsetzung der Projekte; meine Frau ist ein wichtiges Korrektiv im kreativen Prozess, weil sie den fachlichen Blick hat und ihre Nachfragen und Einwände eben fundiert sind. Eine tragende Säule sind heute rund 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über die Jahre zu Spezialisten geworden sind. Zusätzlich braucht man bei Projekten dieser Art auch eine Vielzahl an Fachplanern, die den Architekten mit ihrem Wissen unterstützen und begleiten – darum ist Theaterarchitektur neben dem Krankenhausbau eine der größten Herausforderungen.

Dauert deswegen so eine Generalüberholung oft deutlich länger – und wird meist auch deutlich teurer?
Walter Achatz: Technisch haben wir ja jetzt dazu schon vieles genannt. Hinzu kommen meist nicht öffentlich kommunizierte Änderungswünsche – wir sind jetzt in Augsburg bei einer bemerkenswerten Vielzahl von Änderungsanträgen … Und damit ist ein Wort gefallen: Kommunikation. Am besten von Anfang an: Da gibt es eine Ausschreibung nach der VgV, der Vergabeverordnung, mit einer Zahl für die Kosten. Erstes Problem: Das ist keine wirklich realistische, sondern eine „politische Zahl“, eine „Bürgermeisterzahl“. Wenn Sie heute gleich zu Anfang die wahrscheinlichen Kosten öffentlich nennen, ist der ebenfalls öffentliche Protest so groß, dass das Vorhaben nicht zustande kommt. Dann folgt ein Wettbewerb. Wenn Sie da – aufgrund Ihrer Einschätzung der realen Bauanforderungen – zu weit über der „Bürgermeisterzahl“ liegen …
Emanuela Hualla Achatz: Nenn das Beispiel Coburg: Dort waren 68 Millionen Euro als Obergrenze angegeben …
Walter Achatz: … heute wird über 190 Millionen Euro diskutiert – und ich sehe eine deutlich höhere Endsumme. Wir sind in Coburg übrigens bei der Bewerbung ausgeschieden. Zurück zum Ablauf: Sie gewinnen den Wettbewerb; Auftraggeber ist der Staat, das Bundesland oder die Stadt, beispielsweise Augsburg. Bauherr ist dann das Stadtbauamt, der Bauamtsleiter. Und jetzt wieder das Stichwort „Kommunikation“: die Pressestelle der Stadt plus die Pressestelle des Bauamts plus die Pressestellen der zuvor genannten Ämter plus die Presse … Dann leben wir in einer lebendigen Demokratie: Im Verlauf des Bauvorhabens gibt es Wahlen – und plötzlich haben Sie andere, neue Amtsinhaber vom Bürgermeister abwärts bis zum Intendanten und dem Technischen Direktor des Theaters. So geschehen in Augsburg: eine fast komplette personelle Veränderung auf allen Posten. Da werden von den neuen Amtsinhabern gern eigene „Akzente“ gesetzt, öffentlich kommuniziert, diskutiert – und wir sollen sie bauen.
Emanuela Hualla Achatz: Dazu das Gegenbeispiel Cuvilliéstheater. Bauherr war der kunst- und theaterbegeisterte Finanzminister Faltlhauser. Der kam regelmäßig zu den Sitzungen, ließ sich die nächsten Schritte erklären, äußerte Wünsche, fragte nach – und entschied dann: „Das nicht, aber so und so machen wir das!“ Kein Durchsetzungsproblem, die Kosten liefen nicht aus dem Ruder – so geht das auch.
Walter Achatz: Noch ein kleiner Seitenblick: Wir bauen parallel auch „Theater des kleinen Mannes“ – Kinos zwischen Island und Wladiwostok. Im gleichen Zeitraum von den Kammerspielen bis jetzt Augsburg und Darmstadt haben wir weit über hundert Kinos gebaut.
Welcher andere Beruf käme für Sie infrage? Gibt es den überhaupt?
Walter Achatz: (zu seiner Frau) Darf ich für uns beide antworten? Architektur ist kein Job oder nur Profession, sondern unsere Berufung. Wir arbeiten einfach gerne mit und für diese kreativen, leidenschaftlichen Theatermenschen. Und was gibt es Schöneres, als anonym in einem von uns sanierten Theater zu sitzen und Sätze zu hören wie „Ah, das schaut ja aus wie immer!“ oder „Oh, das ist aber schön geworden!“. Das ist Erfüllung.
Dieses Interview ist eine Leseprobe aus unserer Ausgabe November/Dezember 2021